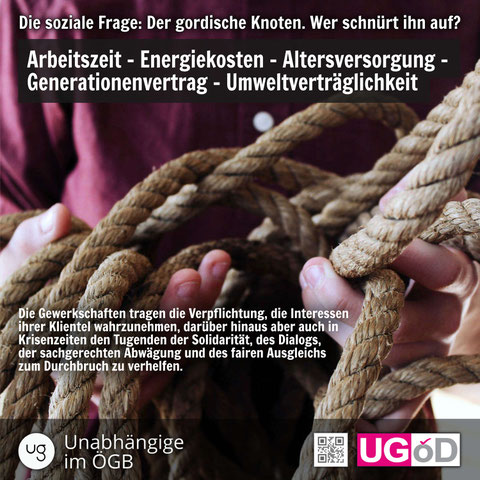
Solidarität, Dialog, sachgerechte Abwägung, fairer Ausgleich
Anstatt überholte Pfründe zu verteidigen, böte die Budgetkrise eine gute Gelegenheit umzudenken und echte Innovationsbereitschaft zu entwickeln, überkommene Denkmodelle durch zeitgemäße zu ersetzen und das vielbeschworene krisenbedingte Erfordernis der Gemeinsamkeit mit Gerechtigkeit zu prägen.
Anstatt überholte Pfründe zu verteidigen, böte die Budgetkrise eine gute Gelegenheit umzudenken und echte Innovationsbereitschaft zu entwickeln, überkommene Denkmodelle durch zeitgemäße zu ersetzen und das vielbeschworene krisenbedingte Erfordernis der Gemeinsamkeit mit Gerechtigkeit zu prägen.
Geht es um den „Faktor Arbeit“, also um die Arbeitskraft, die von Menschen gegen Entgelt zur Verfügung gestellt wird, merkt man bereits am Wording, dass sich die meisten Diskussionen zum Thema immer stärker entmenschlichen und auf wirtschaftliche Begrifflichkeiten reduziert werden: Lohnstückkosten, -nebenkosten und -zurückhaltung, Körperschaftssteuer, etc. Schnell ist man mit der Forderung nach Nulllohnrunden zur Stelle, wenn sich der Staat beim Budget um Milliarden verhaut, ohne daran zu denken, dass es hier um den Wesenskern dessen geht, was wirtschaftlicher Output wirklich ist, nämlich das Resultat menschlicher Leistungen. Zu allem Überdruss spielen sich diese Diskussionen in erschreckend überkommenen und stagnierenden Denkmustern ab, so, als wäre die Zeit seit der industriellen Revolution im 18. Jahrhundert stehen geblieben. Nicht anders lässt sich die Hysterie bewerten, mit der der längst überfälligen Forderung nach Neubewertung der Arbeitszeit begegnet wird, sobald der Begriff „Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich“ auch nur im leisesten Pianissimo tönt.
Der Schweizer Ökonom Mathias Binswanger sagt: „Unser größtes Problem ist, dass wir nach wie vor in Anwesenheit denken und die Leute auch für ihre Anwesenheit bezahlen. Was sagt der Aufenthalt in einem bestimmten Gebäude über Leistung aus?“ Und weiter: Es „ist nicht mehr die Menge der Arbeit entscheidend, sondern wie intelligent man mit neuen Technologien umgeht.“ Nur, Intelligenz ist leider nicht das im Vordergrund stehende Leitprinzip in einer Unternehmenskultur, sonst müsste anerkannt werden, dass flexible Arbeitszeiten (im dem heutigen technologischen Stand entsprechenden Ausmaß!) im beiderseitigen Interesse liegen, den Ausgleich zwischen beruflichen und häuslichen/familiären Pflichten besser herstellen können und der Tatsache Rechnung tragen, dass berufliche Leistungen nach über 200 Jahren nicht mehr in diesem Maße ortsabhängig sind, als das in Ermangelung heutiger Kommunikationstechnologien der Fall war. Dennoch frönt man stattdessen weiterhin einer Kultur der Unzufriedenheit, zieht sarkastisch den Begriff „Work-Life-Balance“ ins Lächerliche und reagiert auf die gewerkschaftliche Forderung nach Neubewertung der Arbeitszeit (Stichwort: Arbeit neu denken) mit unreflektiertem „wir brauchen Leute, die mehr arbeiten und nicht weniger“, um am Markt konkurrenzfähig zu werden. Mit Intelligenz hat das freilich gar nichts zu tun. Und wo bleibt die Leistung der Player auf der Seite der Arbeitgeber:innen?
Seit Beginn der Pandemie und dem von Russland losgetretenen Krieg zahlen Österreichs Bürger:innen, aber auch Unternehmen, unverschämt hohe Energiepreise, 2023 waren es Preiserhöhungen bis zu 266%! Es ist bemerkenswert, dass ein marktwirtschaftlich orientiertes Land wie die Schweiz in dieser Situation imstande war, durch Regulierungsmaßnahmen exzessive Übergewinne auf Kosten der Bevölkerung zu verhindern. Hingegen konnten Österreichs Unternehmen auf dem freien, ungeregelten Markt ihre Übergewinne ungeniert lukrieren, flankiert von nur scheinheilig mitgetragenen Sanktionen gegen Russland, obwohl große Mengen relativ günstigen Gases von dort importiert wurden. Die Bevölkerung jedoch blieb wegen Merit Order auf den unverschämt hohen Energiepreisen sitzen. Was seither geschah: Den Strompreiskostenausgleich für Unternehmen wird es aller Voraussicht nach weiterhin geben, für die Bürger:innen hingegen gibt es nichts Vergleichbares mehr. Wo bleibt die Leistung auf Seiten der Unternehmensseite, die Solidarität, die Sanierungsbeteiligung am Staatshaushalt? Dennoch meint Franz Schellhorn, Direktor der Denkfabrik Agenda Austria: „Was dieses Land braucht, ist kein Eingriff in die Preisbildung. Was dieses Land braucht, ist ein lebendiger Preiskampf zwischen in- und ausländischen Anbietern zum Wohl der österreichischen Verbraucher.“ Echt jetzt? Unser Land hätte allen Grund alles dafür zu tun, damit seine Unternehmenskultur nicht reflexartig mit Namen wie Braun, Marsalik und Benko in Verbindung gebracht wird.
Bislang ist der Beteiligungskatalog am Sanierungsprogramm des Staatshaushalts sehr selektiv. Den Anfang machten schon diese Woche die Ältesten und Schwächsten, deren Lobby eingestehen musste, dass sie bestenfalls das Schlimmste verhindern konnten. „Das Schlimmste“ wurde noch nicht definiert, aber die Grenze zur Respektlosigkeit wurde eindeutig überschritten. Im Ergebnis wurde für die Pensionist:innen das Instrument des „sozialen Abschlusses“ für Gehaltsanpassungen abkopiert. Die Sinnhaftigkeit leidet wegen mangelnder Vergleichbarkeit mit Aktiven schon deshalb, weil die Teuerungsrate v. a. für alleinlebende Pensionist:innen mit 3% höher als der Anpassungsfaktor für die Gesamtbevölkerung liegt, anders gesagt: Alle Pensionist:innen – auch jene mit Niedrigpensionen – erhalten keine volle Abgeltung der Inflation. Wenn man nun den Zusammenhang mit den geplanten Einschnitten für die Gehaltsabschlüsse der Beamteten und Vertragsbediensteten herstellt, so wird es für die Einhaltung des Generationenvertrags schon deshalb eng, weil die Gehälter dieser Gruppe rückwirkend mit 1.1.2025 unter der Inflation liegen werden. Das wird sich noch dadurch verschärfen, dass die Inszenierung des weiteren Procederes durch die Regierung darauf abzielt, Fakten zu schaffen und damit Folgewirkungen für die Privatwirtschaft herzustellen mit dem Ziel, allen Beschäftigten die volle Inflationsabgeltung zu verweigern.
Im Ergebnis würde die Gesamtheit der in Österreich arbeitenden und im Ruhestand befindlichen Personen den weitaus überwiegenden Teil der Staatsverschuldung tragen und refinanzieren müssen.
Das kann und darf so nicht hingenommen werden!
Die Gewerkschaften tragen die Verpflichtung die Interessen ihrer Klientel wahrzunehmen, darüber hinaus aber auch in Krisenzeiten den Tugenden der Solidarität, des Dialogs, der sachgerechten Abwägung und des fairen Ausgleichs zum Durchbruch zu verhelfen.
Die Fraktion der unabhängigen Gewerkschafter:innen fordert jenen Mut zur Wahrheit ein, die klarstellt, dass die fundamentale Verantwortung für Österreichs Budgetkrise darin liegt, dass der damalige ÖVP-Finanzminister das wahre Ausmaß der Staatsverschuldung vor den Nationalratswahlen verschleiert hat.
Dem aktuellen ÖVP-Bundeskanzler wird dringend empfohlen, mit besonders ausgeprägtem Augenmaß auf Gehaltsverhandlungen einzuwirken, die nach den aktuellen Absichtserklärungen sich in Richtung Vertrags- und Gesetzesbruch mittels provokanter Anlassgesetzgebung bewegen könnten.
Den NEOS sei ins Stammbuch geschrieben, dass sie sich wenigstens jetzt als mitregierende Partei mit dem Wesen und der Bedeutung der Sozialpartnerschaft ernsthaft auseinandersetzen mögen und sich kindischen Drohungen enthalten sollen: Was immer Österreich „eingepreist“ haben mag: In einem EU-Defizitverfahren „pickt“ gar nichts, weil es sich um einen gemeinsamen konsensual ausgerichteten Prozess handelt, der sozialpartnerschaftliche Einigungen nicht ersetzen kann.
Den politischen Parteien sei weiters ins Stammbuch geschrieben, dass Leistungsträger:innen erst dann etwas abverlangt werden sollte, wenn sie im eigenen Bereich vergleichbare Leistungen vorweisen können. Der sprunghafte Anstieg von Mitarbeiter:innen in den Ministerkabinetten auf mittlerweile fast 400 Personen (Kosten: rund 3,5 Mill. Euro) belegt eindrücklich, dass meist gerade jene nicht sparen, die es von anderen verlangen. Auch der zweifelhafte „Ruhm“ des früheren FPÖ-Ministers Kickl, der teuerste Innenminister aller Zeiten gewesen zu sein, dürfte einer Oppositionspartei schlecht zu Gesicht stehen, wenn man vorgibt, den „Volkskörper“ (sic!) vor ungerechten Belastungen bewahren zu wollen.
Ein konstruktiver Sparvorschlag zum Schluss:
Österreich muss jetzt ganz schnell etwas tun, um seine Wirtschaft umweltfreundlicher zu machen. Wir müssen weg von den alten, schädlichen Geschäftsmodellen, die von Kohle, Öl und Gas abhängen. Stattdessen brauchen wir neue, schlaue Ideen und Firmen, die Gutes für die Umwelt tun und auch in Zukunft erfolgreich sind.
Das ist nicht nur eine Idee für die Umwelt, sondern auch eine wichtige Sache, wenn es ums Geld geht – besonders jetzt, wo über das Budget geredet wird. Wir brauchen diese großen Veränderungen in der Politik, um unsere Zukunft und unser Überleben zu sichern. Es ist also eine Frage des Geldes, der Arbeitsplätze und unserer Zukunft, die eng miteinander verbunden sind.
Ingo Hackl, UGÖD Vorsitzender
Stefan Schön, Pressesprecher




